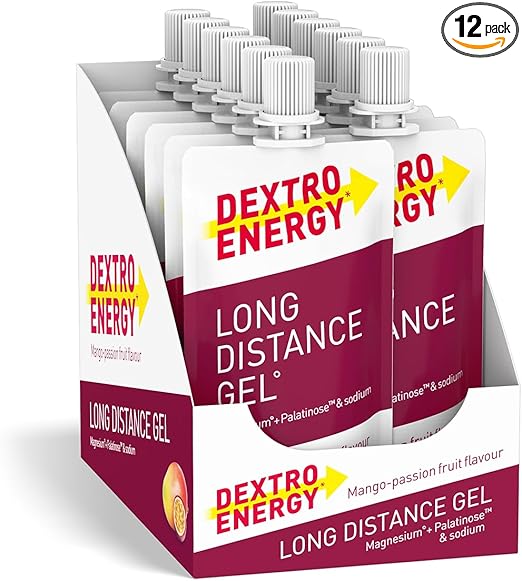22. April 2025, 16:00 Uhr | Lesezeit: 8 Minuten
Bewegung ist wichtig für die allgemeine Gesundheit und für die Herzgesundheit im Speziellen. Die einfachste Art der Bewegung: Gehen. Dass man bereits von dieser niedrigschwelligen Aktivität profitieren kann, konnte die Forschung in Studien belegen. Inwiefern das Gehtempo eine Rolle spielt, zeigt eine aktuelle Untersuchung, die den Effekt von Gehen auf das Risiko für Herzrhythmusstörungen erforscht hat.
Ein täglicher Spaziergang sorgt nicht nur für mehr Schritte auf der Fitnessuhr. Er hat auch zahlreiche wohltuende Effekte für Körper und Geist. Auch, wer speziell für sein Herz Gutes tun möchte, sollte regelmäßig gehen. Idealerweise sollte man dabei aber nicht schlendern, sondern versuchen, ein bestimmtes flottes Tempo einzuhalten. Dann zumindest senkt sich das Risiko für Herzrhythmusstörungen – so das Ergebnis einer Studie von Forschenden der Universität Glasgow.
Übersicht
- Tod infolge von Herzrhythmusstörungen
- Ziel der Studie aus Glasgow
- Das hat die Studie untersucht
- Schneller als 6 Kilometer pro Stunde gehen, senkt offenbar Risiko für Herzrhythmusstörungen
- Bedeutung der Studienergebnisse
- Einordnung der Studie und mögliche Einschränkungen
- Schneller gehen und das Fitnesslevel verbessern
- Quellen
Tod infolge von Herzrhythmusstörungen
Herzrhythmusstörungen mit Folgen wie Schlaganfall oder plötzlicher Herztod gehören zu den zehn häufigsten Todesursachen in Deutschland. Neben der Herzinsuffizienz verursachen sie die meisten Krankenhausaufenthalte. Allein am durch Herzrhythmusstörungen ausgelösten plötzlichen Herztod sterben jedes Jahr in Deutschland über 65.000 Menschen.1
Ziel der Studie aus Glasgow
Da Bewegung nachweislich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt (das bestätigte uns auch FITBOOK Expert Dr. Christopher Schneeweis), lag die Vermutung nahe, dass auch das Gehtempo – ein einfacher Indikator für Fitness – eine Rolle bei der Entstehung von Arrhythmien spielen könnte. Bisher fehlten jedoch groß angelegte Studien, die diesen Zusammenhang gezielt untersuchten, insbesondere unter Einbezug objektiver Messdaten wie von Beschleunigungssensoren. Die vorliegende Untersuchung wollte diese Lücke schließen – und zudem mögliche Prozesse im Körper aufzeigen, die durch das Gehen in einer speziellen Geschwindigkeit beeinflusst werden. Was sie außerdem herausarbeitete: Dass bestimmte Personen von der Einhaltung des besagten Gehtempos stärker profitierten als andere.
Das hat die Studie untersucht
Bei der Studie handelt es sich um eine retrospektive Kohortenstudie unter Verwendung von Daten der UK Biobank. Retrospektive Studien schauen von einem Ereignis ausgehend (in diesem Fall das Auftreten von Herzrhythmusstörungen) zurück, um einen möglichen Zusammenhang zu bestimmten Faktoren (hier das Gehen in einem bestimmten Tempo) zu ermitteln.2
Insgesamt wurden 420.925 Personen im Alter von 40 bis 69 Jahren einbezogen, die zwischen 2006 und 2010 rekrutiert wurden. Die Nachbeobachtungszeit betrug im Durchschnitt 13 Jahre. 81.956 Teilnehmende trugen zwischen 2013 und 2015 eine Woche lang ein Beschleunigungsmessgerät am Handgelenk. Auf diesem Weg konnte das Gehtempo objektiv erfasst werden. Neben den Bewegungsdaten kamen auch Fragebögen zum Einsatz. In ihnen schätzten die Probanden selbst ein, ob ihr Gehtempo „langsam“ (weniger als 3 Meilen pro Stunde/4,8 Kilometer pro Stunde), „durchschnittlich“ (3 bis 4 Meilen pro Stunde/4,8 bis 6,4 Kilometer pro Stunde) oder „zügig“ (mehr als 4 Meilen pro Stunde/6,4 Kilometer pro Stunde) ist.
Die Diagnose von Herzrhythmusstörungen – darunter Vorhofflimmern, Bradyarrhythmien und ventrikuläre Arrhythmien – erfolgte anhand von Krankenhausdaten. Mittels Cox-Regressionsmodellen (für Zusammenhänge statistisch bewährtes Analyseverfahren) wurden die Zusammenhänge zwischen Gehtempo und Arrhythmien analysiert. Zusätzlich wurde eine Mediationsanalyse durchgeführt. Diese Methodik diente dazu, Faktoren zu ermitteln, auf die das Gehtempo womöglich einwirken könnte, was wiederum den positiven Effekt auf das Herz haben könnte. Genauer analysierten die Wissenschaftler so den Einfluss des Gehens in unterschiedlicher Geschwindigkeit auf metabolische (z. B. BMI, Blutzucker, Cholesterin) und entzündliche Parameter (C-reaktives Protein) zu bewerten.
Welche Risikofaktoren für Herzerkrankungen laut Kardiologe Dr. Schneeweis vermeidbar sind, erfahren Sie im folgenden Video:
Schneller als 6 Kilometer pro Stunde gehen, senkt offenbar Risiko für Herzrhythmusstörungen
Während der durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 13 Jahren entwickelten 36.574 Teilnehmer Herzrhythmusstörungen. 23.526 von ihnen erhielten die Diagnose Vorhofflimmern,19.093 erlitten andere Herzrhythmusstörungen, 5678 hatten Bradyarrhythmien (langsamer Herzschlag) und 2168 ventrikuläre Arrhythmien (Störungen in den Herzkammern).
In Zusammenhang gesetzt mit dem Gehtempo zeigte sich: Studienteilnehmer, die zügig gingen, hatten ein deutlich geringeres Risiko, eine Herzrhythmusstörung zu entwickeln – darunter auch Vorhofflimmern, die weltweit häufigste Form.
Personen, die im Fragebogen angegeben hatten, mit durchschnittlichem Tempo (4,8 bis 6,4 Kilometer pro Stunde) zu gehen, hatten ein um 35 Prozent geringeres Risiko. Personen mit zügigem Tempo (schneller als 6,4 Kilometer pro Stunde) hatten sogar ein um 43 Prozent geringeres Risiko für Herzrhythmusstörungen. Beide Erkenntnisse beziehen sich auf den Vergleich zu langsamen Gehern (langsamer als 4,8 Kilometer pro Stunde).
Diese Ergebnisse galten nicht nur für das Gesamtbild der Herzrhythmusstörungen, sondern auch für einzelne Formen wie Vorhofflimmern, Bradyarrhythmien und ventrikuläre Arrhythmien.
Auch objektiv gemessene Daten aus Bewegungssensoren bestätigten den Trend. Menschen, die mehr Zeit mit moderatem oder zügigem Gehen verbrachten, hatten ein klar geringeres Risiko. Wer hingegen viel langsam ging, hatte keinen messbaren Schutz.
Besonders interessant: Rund ein Drittel des positiven Effekts korrelierte mit besseren Werten bei Gewicht, Blutzucker, Blutdruck, Cholesterin und Entzündungswerten. Die Minimierung dieser typischen Risikofaktoren für Herzerkrankungen könnte daher eine Erklärung für den positiven Effekt schnellen Gehens auf das Herz haben.
Zusätzlich zeigte sich, dass der schützende Effekt besonders stark war bei Frauen, Menschen unter 60 Jahren, nicht übergewichtigen Personen und solchen mit mehreren chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes. Das unterstreicht: Gerade für Menschen mit gesundheitlichen Risiken kann ein flotteres Gehtempo besonders hilfreich sein.
Bedeutung der Studienergebnisse
Die Studie liefert erstmals umfassende Hinweise darauf, dass ein höheres Gehtempo – sowohl subjektiv wahrgenommen als auch objektiv gemessen – mit einem deutlich geringeren Risiko für Herzrhythmusstörungen einhergehen könnte. Besonders relevant scheint dies für Personen mit erhöhtem Risiko, etwa durch Bluthochdruck, Übergewicht oder bestehende chronische Erkrankungen, zu sein. Zudem zeigt die Mediationsanalyse, dass metabolische und entzündliche Prozesse eine zentrale Rolle spielen könnten: Wer schneller ging, hatte meist bessere Stoffwechsel- und Entzündungswerte, was offenbar wiederum das Arrhythmierisiko senkte.
Für die Prävention bedeutet das: Bereits eine einfache Anpassung der Alltagsbewegung könnte messbare Vorteile bringen. Auch im Hinblick auf Sekundärprävention, etwa bei Bluthochdruckpatienten, könnte das zügige Gehen künftig ein niederschwelliges Interventionsziel sein.

Studie motiviert, im Alltag häufiger flotter zu gehen
„Vielleicht sind Sie bereits ein leidenschaftlicher Spaziergänger, aber mögen es bisher eher, schön gemütlich zu schlendern? Dann könnten die aktuellen Studienerkenntnisse vielleicht ermutigen, das Tempo ein bisschen zu variieren. Gehen Sie doch mal so schnell, dass es Sie deutlich mehr anstrengt, Sie vielleicht nicht mehr soeben ein Gespräch führen könnten. Bei einem einstündigen Sparziergang könnte man vielleicht auf dem Rückweg für fünf bis zehn Minuten flotter gehen, gefolgt von weiteren fünf Minuten langsameren Gehens, bevor Sie wieder zu Hause ankommen. Wer weniger Zeit und Lust für Spaziergänge hat (sollte dies am besten ändern), kann vielleicht den Heimweg von der Arbeit oder den Weg zum Supermarkt und zurück dafür nutzen. Weiterer Vorteil hier: Man hat dank der Einkäufe noch ein Gewicht, das das Traning durch das schnellere Gehen sogar noch effektiver macht.“
Einordnung der Studie und mögliche Einschränkungen
Eine Stärke der vorliegenden Untersuchung sind die große Teilnehmerzahl und damit der umfangreiche Datensatz sowie die lange Nachbeobachtungsdauer und den kombinierten Einsatz von subjektiven und objektiven Messmethoden. Die Verwendung von Beschleunigungsmessern erhöht die Datenqualität erheblich und reduziert Verzerrungen durch Erinnerungslücken.
Dennoch bestehen einige Einschränkungen: Die Messung des Gehtempos per Sensor erfasste alle Schritte – auch jene in der Wohnung –, wodurch der Anteil zügigen Gehens unter- oder überschätzt werden könnte. Auch erfolgte die Messung mit dem Tracker nur über einen Zeitraum von sieben Tagen. Zudem war die Teilnehmerrate in der Accelerometer-Stichprobe relativ gering (45 Prozent). Die Aussagekraft der objektiven Gehtempo-Messung für das Auftreten gesundheitlicher Ereignisse bis zu 13 Jahre später ist daher fraglich.
Auch die generelle Übertragbarkeit der Ergebnisse ist begrenzt, da die UK Biobank vorwiegend weiße, gesunde Personen mittleren Alters umfasst. Schließlich kann trotz umfassender Adjustierung eine Restverzerrung durch unbekannte Einflussfaktoren nie vollständig ausgeschlossen werden. Dennoch untermauern die konsistenten Ergebnisse – auch in Subgruppenanalysen (Geschlechter-spezifisch, chronisch Erkrankte usw.) – die Aussagekraft der Studie deutlich.

Spazieren kann vor Demenz schützen – wenn man es richtig macht

Das Gehtempo verrät, wie stark man gealtert ist

Einfacher Trick beim Gehen hält offenbar länger jung
Schneller gehen und das Fitnesslevel verbessern
Trotz ihrer Einschränkungen liefert die groß angelegte britische Kohortenstudie interessante Erkenntnisse, die weiter die Bedeutung von Bewegung für ein gesundes Herz unterstreicht. Schon mit Gehen kann offenbar einiges bewirkt werden. Und nun wissen wir, dass wir den Effekt womöglich noch erhöhen können, wenn wir auf ein bestimmtes Tempo achten, zumindest, wenn es um den Schutz vor Herzrhythmusstörungen geht.
Besonders Frauen und Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes scheinen zu profitieren. Auch, wenn weitere Forschung notwendig ist, um alle Zweifel über die Wirkung des Gehtempos aus der Welt zu schaffen: Schneller gehen ist gut für das Fitnesslevel. Und einem höheren Fitnesslevel werden basierend auf Studien diverse Vorteile nachgesagt. Darunter ein gewisser Schutz vor Krebserkrankungen sowie Alzheimer und der Entwicklung einer Depression.3,4,5 Also rein in die Schuhe und ab zum flotten Spaziergang.