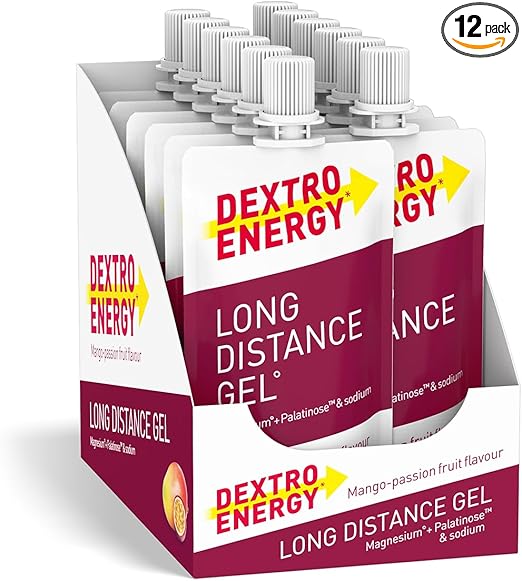2. Juni 2025, 20:02 Uhr | Lesezeit: 7 Minuten
Laufschuhe sollen die Gelenke schützen – doch fast 40 Prozent versagen im Test! Eine neue Studie deckt auf: Viele Modelle sind entweder zu weich oder zu hart – und damit ein Risiko für Verletzungen. Forschende aus Bayreuth haben 112 Schuhe auf ihre Dämpfungsleistung geprüft und alarmierende Konstruktionsfehler entdeckt. Welche Modelle überzeugen – und welche man zum Joggen besser nicht schnürt.
Laufschuhe sollen beim Aufprall Dämpfung liefern, aber tun sie das wirklich? Eine neue Studie deckt auf: Viele Modelle sind falsch konstruiert. Statt Energie optimal zu absorbieren, überfordern sie die Füße oder bieten zu wenig Schutz. Forschende aus Bayreuth haben dutzende Laufschuhe auf ihre Dämpfungseigenschaften im Fersenbereich geprüft – mit teils alarmierenden Ergebnissen. Fast 40 Prozent der Schuhe waren entweder zu hart oder zu weich.
Übersicht
- Zweck der Studie
- Dämpfung von Laufschuhen – so haben die Forscher untersucht
- Alter und Kilometerumfang der Studienteilnehmer
- Ergebnis: Studie offenbart gravierende Konstruktionsfehler bei viele Laufschuhen Top-Marken
- Diese Laufschuh-Modelle haben eine optimale Dämpfung
- Modelle mit „okayer“ Dämpfung
- Laufschuhe mit unzureichender Dämpfung
- Fazit – was bedeutet das für mich als Läufer?
- Quellen
Zweck der Studie
Die Studie wurde von Franz Konstantin Fuss, Tizian Scharl und Niko Nagengast an der Universität Bayreuth und dem Fraunhofer IPA durchgeführt. Veröffentlicht wurde sie im Fachjournal „Bioengineering“.1 Ziel der Arbeit war es, ein objektives Verfahren zur Bewertung der Dämpfungseigenschaften von Laufschuhen zu entwickeln. Statt wie bisher nach Norm mit fixen Prüfwerten (z. B. 5 Joule Energieaufnahme) zu testen, nutzt das neue Verfahren sogenannte Schulterpunkt-Parameter – die optimale Kombination aus Kraft und Energieaufnahme. Diese Herangehensweise offenbart nicht nur Leistungsunterschiede zwischen Schuhen, sondern deckt auch Konstruktionsfehler auf. Ein überraschendes Ergebnis: Selbst namhafte Marken zeigen deutliche Schwächen – oft wahrscheinlich ungewollt, weil sie bisherige Testnormen zu wenig hinterfragen.
Dämpfung von Laufschuhen – so haben die Forscher untersucht
Laufschuhe sollen Stoßkräfte beim Auftreten reduzieren, um Verletzungen zu vermeiden. Die bisher üblichen Prüfstandards, etwa nach ASTM, testen Schuhe bei einer fixen Energiebelastung – meist 5 Joule. Das Problem: Jeder Mensch läuft anders, mit unterschiedlichen Kräften und Energien, abhängig von Körpergewicht, Tempo und Laufstil. Leichtgewichte und schwere Athleten, langsame und schnelle Läufer – sie alle wirken unterschiedlich auf einen Schuh ein.
Genau hier setzt die Bayreuther Studie an: Getestet wurde nicht wie üblich bei einer fixen Energie (z. B. 5 J). Die Forscher nutzten eine neue Messgröße, den sogenannten „Shoulder Point“. Dabei handelt es sich um den Punkt, an dem ein Schuh die meiste Energie mit dem geringsten Kraftaufwand dämpft. Anders ausgedrückt: Am „Shoulder Point“ nimmt das Dämpfungselement am effizientesten Energie auf.
Dafür wurden vier Schlüsselwerte ermittelt:
- das optimale Energie-Kraft-Verhältnis (E/Fmax); idealerweise hoch
- die zugehörige Kraft (Fopt); passend zum Körpergewicht des Läufers
- die Verschiebung (xopt); zeigt, wie weit der Schuh nachgibt und
- die Energieaufnahme (Eopt); je mehr, desto besser
Zusätzlich untersuchte man die Abhängigkeit der Dämpfungsleistung von Geschwindigkeit, Schuhgröße, Insohle und Einlaufphase sowie die Reproduzierbarkeit der Methode. Ein weiterer Teil der Studie erfasste bei 37 Läufern die realen Fersenaufprallkräfte (PF1) beim Laufen auf einer Kraftmessplatte – um zu prüfen, ob diese mit dem optimalen Dämpfungsbereich der Schuhe übereinstimmen. So konnte nicht nur die Konstruktion der Schuhe bewertet, sondern auch deren Passung zur tatsächlichen Laufbelastung getestet werden.
Alter und Kilometerumfang der Studienteilnehmer
Für die biomechanische Analyse der Laufschuhe wurden insgesamt 37 Testpersonen (19 Frauen, 18 Männer) im Alter von 20 bis 45 Jahren untersucht. Alle Teilnehmenden waren freizeitorientierte, regelmäßig laufende Personen mit einer Mindestlaufleistung von zwölf Kilometern pro Woche. Die Tests fanden unter kontrollierten Bedingungen auf dem Laufband und auf einer Kraftmessplatte statt – bei standardisierten Geschwindigkeiten (10 km/h) sowie bei der individuellen Wohlfühlgeschwindigkeit.
Auch interessant: Die optimale Uhrzeit zum Laufschuh-Kauf
Ergebnis: Studie offenbart gravierende Konstruktionsfehler bei viele Laufschuhen Top-Marken
Die neue Methode zeigte, dass viele Laufschuhe falsch konstruiert sind – entweder zu hart (überdesignt), zu weich (unterdesignt) oder selten optimal abgestimmt. Der entscheidende Wert E/Fmax (Joule pro Kilonewton) reichte von minimal 0,6 J/kN (Barfußschuh) bis zu 11,2 J/kN (Puma RuleBreaker). Die beste Dämpfungsleistung zeigten Schuhe mit E/Fmax zwischen 7 und 11 J/kN.
Interessant: Viele Modelle waren zwar weich, aber nicht im optimalen Belastungsbereich. Nur wenn Fopt – die ideale Kraft beim Schulterpunkt – mit der realen Fersenaufprallkraft PF1 übereinstimmt, kann der Schuh seine Dämpfungspotenziale ausschöpfen. Dies war bei langsamer Laufgeschwindigkeit (10 km/h) fast immer der Fall.
Bei höherem Tempo (individuelle Trainingsgeschwindigkeit) liefen jedoch viele Teilnehmer außerhalb des optimalen Bereichs. Das betraf vor allem schwerere Läufer mit großen Schuhgrößen. Die Konsequenz: Selbst gut gedämpfte Schuhe können bei höheren Belastungen versagen, wenn die Konstruktion nicht angepasst wird!
Der neue Test identifizierte außerdem klare Trends zwischen Herstellern. Puma und 3D-gedruckte Schuhe zeigten überdurchschnittliche Werte bei E/Fmax. Adidas-Schuhe mit Bounce-Technologie waren oft überdesignt, während minimalistisches Schuhwerk wie Vivobarefoot deutlich unterdurchschnittliche Dämpfungswerte aufwies.
Diese Laufschuh-Modelle haben eine optimale Dämpfung
Die folgenden Modelle wurden ausdrücklich als positiv hervorgehoben oder erfüllten die Anforderungen an eine gelungene Dämpfung im relevanten Belastungsbereich:
- Puma „Rulebreaker“ – mit dem höchsten gemessenen Dämpfungswert (E/Fmax: 11,1 J/kN)
- Nike „Airmax“
- Brooks „Ghost 15“
- Mizuno „Wave Rider“
Diese Modelle lagen im idealen Bereich für den Großteil der Testpersonen im üblichen Belastungsbereich beim Joggen.
Auch interessant: Hendrik Pfeiffer: „Carbon-Laufschuhe bei 100 Kilogramm Körpergewicht sind Schwachsinn“
Modelle mit „okayer“ Dämpfung
Diese Modelle boten im Test eine solide bis gute Dämpfung – zwar nicht absolute Spitze, aber klar im grünen Bereich:
- Asics „Nimbus“
- Asics „Gel Kayano 17“
- Brooks „Ghost 11“
- Nike „Free 5.0“
- Puma „Deviate Elite 2“, „Velocity 2“ und „Liberate“
- CEP „Omnispeed Prototype“
- Saucony „Endorphin“
Laufschuhe mit unzureichender Dämpfung
Zur Einordnung: Laufschuhe mit E/Fmax < 3.5 J/kN und/oder xopt < 13.5 mm wurden als im Fersenbereich unzureichend dämpfend identifiziert – dazu gehören diese Modelle:
- Vivobarefoot „Primus Lite“
- Vibram „Bikila (FiveFingers)“
- INov-8 „roadx233“
- Joe Nimble „Addict“
- Nike „Zoom Hyperfuse“
- New balance „550“ und „1150“
- Adidas „Fluidstreet
Warum diese Schuhe problematisch sein können
- Sie dämpfen die Aufprallenergie beim Fersenaufsatz nicht ausreichend, sodass der Stoß in Gelenke und Weichteile weitergeleitet wird.
- Besonders bei Fersenläufern (fast alle Läufer in der Studie) ist das ein Risiko für Überlastungssyndrome, z. B. in Knie, Achillessehne oder Plantarfaszie.
- Der Mangel an Dämpfung resultiert oft entweder aus absichtlich minimalem Design oder aus Abnutzung (z. B. bei älteren Laufschuhen).

Die 11 besten Laufschuhe für die Straße im Überblick

Die Laufschuh-Trends für die Saison 2020

Die besten Fußballschuhe für jeden Platz
Fazit – was bedeutet das für mich als Läufer?
Die umfangreiche Studie zeigt, dass viele Modelle fehlkonstruiert sind. Sie bilden die Realität des Laufens nicht ab, weil sie von fixen Energie- oder Kraftwerten ausgehen. Für Läufer bedeutet das: Man sollte künftig Schuhe wählen, die wirklich zum eigenen Körpergewicht und Laufstil passen – was Verletzungsrisiken senkt und Komfort erhöht. Die Hersteller müssen hier aber neu denken. Anstatt Dämpfung nach Gefühl zu konstruieren, kann man gezielt den Schulterpunkt für bestimmte Nutzergruppen optimieren. Langfristig könnte die „Shoulder Point“-Methode auch in neue Normen einfließen und bestehende Prüfstandards wie ASTM F1614 ablösen. Die Studienautoren fordern deshalb eine Ablösung veralteter Normen – und machen den Weg frei für datengestützte, individuelle Schuhberatung.
Einzige Einschränkung der Studie: Die Tests berücksichtigen nicht alle denkbaren Laufstile (z. B. Vorfußlauf). Was diese Einschränkung relativiert: 94 Prozent der Tester waren Fersenläufer.

„Beim nächsten Laufschuhkauf schaue ich genauer hin!“
„Ich bin Fersenläuferin mit etwa 30 bis 40 Wochenkilometern Laufumfang – und das Knie meldet sich inzwischen hier und da, insbesondere beim Straßenlauf. Diese Studie ist für mich deshalb relevant und sie bringt mich hoffentlich dazu, beim nächsten Schuhkauf genauer hinzuschauen. Mitgenommen habe ich: Nur auf Komfort beim Testlauf im Laden zu achten, ist zu wenig. Ich brauche einen Schuh, der biomechanisch zu mir passt. Und dafür wiederum benötige ich Belastungsdaten, die zum individuellen Laufstil passen. So ein individuelles Bewegungsprofil mit Belastungsspitzen kann man in guten Laufschuh-Fachgeschäften bekommen, die die entsprechende Messtechnik haben. Dorthin werde ich dann auch meine Ganganalyse mitnehmen – wurde vor Jahren mal in einem sportmedizinischen Zentrum gemacht, habe mich dann aber nicht mehr wirklich dafür interessiert. Jetzt ahne ich: Sie ist der Schlüssel, um meine Knie langfristig zu entlasten.“