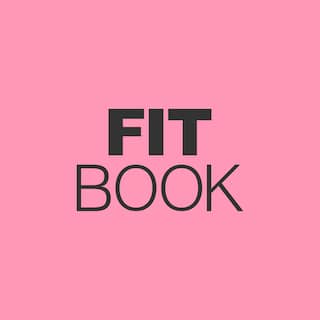
20. Mai 2025, 4:01 Uhr | Lesezeit: 5 Minuten
Wenn beim Gehen plötzlich Schmerzen in den Waden einschießen und erst nach einer Pause nachlassen, steckt möglicherweise mehr dahinter als bloße Muskelverspannung. Hinter der sogenannten „Schaufensterkrankheit“ verbirgt sich eine gefährliche Durchblutungsstörung – die oft lange unbemerkt bleibt, aber ernste Folgen haben kann.
Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), umgangssprachlich Schaufensterkrankheit genannt, betrifft vor allem ältere Menschen. Ursache sind verengte Arterien, die die Beine nicht mehr ausreichend durchbluten. Unbehandelt kann die Erkrankung schwerwiegende Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder sogar Amputationen nach sich ziehen.
Jetzt dem FITBOOK-Kanal bei Whatsapp folgen!
Übersicht
Was ist die pAVK?
Unte einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) versteht man eine chronische Durchblutungsstörung, bei der arterielle Gefäße – meist in den Beinen – durch Ablagerungen verengt oder verschlossen sind. Die dadurch gestörte Blutversorgung verursacht einen Sauerstoffmangel in der Muskulatur. Besonders unter körperlicher Belastung kann dies zu krampfartigen Schmerzen führen. Umgangssprachlich wird sie „Schaufensterkrankheit“ genannt, weil Betroffene beim Gehen oft stehen bleiben müssen – scheinbar, um in ein Schaufenster zu blicken.
Wer ist betroffen und wie viele?
In Deutschland sind laut Deutscher Herzstiftung etwa 15 bis 20 Prozent der über 70-Jährigen von einer pAVK betroffen. Insgesamt leidet rund jeder zehnte Erwachsene daran. Auffällig ist dabei, dass Männer häufiger erkranken als Frauen. In rund 90 Prozent der Fälle sind die Arterien in den Beinen sowie im unteren Bauchraum betroffen – demgegenüber betreffen lediglich etwa 10 Prozent der Fälle die Armarterien.1
Welche Ursachen gibt es für die Erkrankung?
Hauptursache der pAVK ist Arteriosklerose – eine Gefäßverkalkung, bei der sich Fett-, Kalk- und Eiweißablagerungen in den Arterienwänden ansammeln. Zusätzlich verengen sich die Gefäße zunehmend, sodass weniger Sauerstoff und Nährstoffe die Muskulatur erreichen. Besonders beim Gehen steigt der Sauerstoffbedarf in den Muskeln – ist die Durchblutung gestört, kommt es zu Schmerzen. Im Stillstand sinkt der Bedarf, und die Beschwerden lassen nach.
Etwa drei Viertel der Betroffenen verspüren trotz Gefäßverengung zunächst keine Symptome. Der Grund: Der Körper bildet Umgehungsgefäße, die den Blutfluss teilweise kompensieren. Allerdings reicht dieser körpereigene Schutzmechanismus nicht unbegrenzt – weshalb Vorsorge und frühzeitige Erkennung entscheidend sind.2
Folgende Symptome gibt es
Typische Beschwerden der pAVK sind:
- Schmerzen in Waden, Oberschenkeln oder Gesäß beim Gehen
- Kältegefühl in Füßen oder Beinen
- blasse, bläuliche oder kühle Haut
- Taubheit oder Schwächegefühl
- schlecht heilende Wunden
- dünne, verletzliche Haut oder reduzierte Behaarung3
Die Symptome treten häufig erst unter Belastung auf und bessern sich in Ruhe. In fortgeschrittenen Stadien sind Schmerzen auch in Ruhe möglich, vor allem nachts in Füßen und Unterschenkeln. Laut der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) sollten frühe Anzeichen unbedingt ernst genommen und zeitnah abgeklärt werden – denn schreitet die Erkrankung weiter voran, lassen sich aufwändige Gefäßeingriffe oft nicht vermeiden.4
Welche Gefahren und Folgen drohen?
Die pAVK ist ein deutliches Warnsignal für ein erhöhtes Risiko weiterer Gefäßverengungen im Körper. Liegt eine Arteriosklerose in den Beinen vor, ist oft auch das Herz betroffen – etwa in Form einer koronaren Herzkrankheit.
Unbehandelt kann die pAVK schwerwiegende Komplikationen verursachen:
- Herzinfarkt
- Schlaganfall
- Nierenfunktionsstörungen
- chronische Wunden
- Gewebeuntergang bis hin zur Amputation
Nach Angaben der Deutschen Gefäßliga e. V. sinkt die allgemeine Lebenserwartung von Erkrankten im Schnitt um etwa zehn Prozent.5
Welche Stadien gibt es?
Medizinisch wird die pAVK in folgende vier Stadien unterteilt:
- Stadium I: Gefäßverengung ohne Beschwerden.
- Stadium IIa: Schmerzen beim Gehen nach mehr als 200 Metern.
- Stadium IIb: Schmerzen beim Gehen nach weniger als 200 Metern.
- Stadium III: Ruheschmerzen, insbesondere nachts.
- Stadium IV: Geschwüre, abgestorbenes Gewebe, Entzündungen – Gefahr einer Amputation
Die Stadien III und IV gelten als kritische Durchblutungsstörungen und machen eine sofortige medizinische Behandlung erforderlich.
Diagnose der Erkrankung
In der Regel liefern bereits das ärztliche Gespräch über Symptome und Risikofaktoren erste Hinweise; darauf aufbauend kommen anschließend folgende Untersuchungen zum Einsatz:
- Knöchel-Arm-Index: Man vergleicht den Bluthochdruck an Armen und Beinen – ein schnelles, aussagekräftiges Verfahren zur Erkennung einer pAVK
- Bildgebende Verfahren: Mithilfe eines CT- oder einer MR-Angiografie zur exakten Lokalisation von Verengungen und zur Therapieplanung
- Körperliche Untersuchung: Kontrolle von Hautfarbe und Temperatur, Pulstasten an Füßen und Beinen
- Doppler- und Duplex-Ultraschall: Darstellung der Gefäße, Blutströmung und möglicher Engstellen
Alle Untersuchungen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der Radiologie, um eine präzise Diagnose sicherzustellen.

Arteriosklerose-Symptome – diese Warnsignale sollten Sie ernst nehmen

Die positiven Wirkungen der mediterranen Ernährung auf die Gesundheit

Was genau ist Morbus Boeck und wie erkennt man die Erkrankung?
Wie wird pAVK behandelt?
In der Regel richtet sich die Therapie zunächst nach dem Stadium der Erkrankung. Darüber hinaus zielt sie darauf ab, die Durchblutung zu fördern, Beschwerden zu lindern und mögliche Folgekomplikationen wirksam zu verhindern.
Konservative Behandlung
Gehtraining: Regelmäßiges, strukturiertes Gehen steigert die schmerzfreie Gehstrecke, fördert die Bildung von Umgehungsgefäßen und verbessert die Durchblutung. Gerade für Betroffene eignet sich Nordic Walking besonders gut, denn im Vergleich zu anderen Aktivitäten belastet es die Beine deutlich weniger.
Risikofaktor-Kontrolle: Rauchstopp, Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung, Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle
Medikamente: Einsatz von Thrombozytenaggregationshemmern wie Acetylsalicylsäure (Aspirin), um das Risiko für Gefäßverschlüsse zu senken
Operative Verfahren
Ballonkatheter & Stent: Dabei wird unter örtlicher Betäubung zunächst ein Katheter mit einem kleinen Ballon in das verengte Gefäß eingeführt und dort erweitert. Zur Stabilisierung lässt sich anschließend ein Stent einsetzen.
Bypass-Operation: Bei schweren Gefäßverschlüssen wird mithilfe körpereigener Venen oder künstlicher Materialien eine Umleitung des Blutes geschaffen.
Entscheidend für den Behandlungserfolg ist, dass Patient:innen ihre Risikofaktoren aktiv reduzieren – insbesondere das Rauchen. Studien zeigen, dass eine Therapie bei weiterbestehendem Nikotinkonsum oft wirkungslos bleibt.
*Mit Material von dpa

